r0112516

Apr 05, 2010
Christine Pavlic
„die Bank, das Garn und die Bohrmaschine …“


Die Holzlatten von öffentlichen Sitzmöbeln werden mit Löchern durchbohrt und traditionell mit Nadel und Garn bestickt. Dabei werden die lokalen und regionalen Kontexte der Alltagskultur aufgegriffen – in ihrer tradierten Paradoxie und Widersprüchlichkeit. So wird ‘heimische Häuslichkeit’ zwischen Kitsch, Wohlgefühl und Unerträglichkeit zum Thema gemacht, indem die Bänke schlicht zum Sitzen einladen… echte Gefühle für heimatliche Klischees.
an.schläge
das feministische magazin
Die an.schläge berichten nicht nur über so genannte „Frauenthemen“, sondern über das aktuelle politische, gesellschaftliche und kulturelle Geschehen aus feministischer Perspektive. Es geht dabei um das Herstellen einer feministischen Gegenöffentlichkeit, um Parteilichkeit statt Pseudoobjektivität und um das Sichtbarmachen weiblicher Wirklichkeiten und Erfahrungen in einer männlich dominierten (Medien-)Welt. Das Prinzip der kollektiven Redaktion ist hierbei genauso von Bedeutung wie die Offenheit gegenüber vielfältigen feministischen Sichtweisen und Lebensweisen von Frauen. Abos, Spenden und Inserate sind unsere wichtigsten unabhängigen Einnahmequellen. Die an.schläge sind als feministisches Monatsmagazin ein einzigartiges Projekt in der deutschsprachigen Zeitungslandschaft.
Ya Basta
- Zapatismus, Ya Basta und die Tute Bianches -
Ya Basta ist nicht gleich Tute Bianches. Tute Bianches ist
hauptsächlich
eine Aktionsform und ein Selbstverständnis. In ihr erkennen
sich verschiedene Menschen, Gruppierungen und politische
Strömungen;
und prägen somit die Gestaltung der Form.
Ya Basta ist ein Netzwerk von Gruppen, die sich mit dem Aufstand
der Zapatistas in mehreren Städten Italiens gebildet haben
und eine der politischen Strömungen die zur Kristallisierung
der Tute Bianches beigetragen haben: "Die Zapatistas haben
einen wichtigen Beitrag geleistet, mit ihren Ideen Politik zu
machen,
ohne um die Macht zu kämpfen. Wir versuchen diese Botschaft
zu übersetzen und unsere eigene Ausdrucksform zu finden."
Inspiriert wurden die AktivistInnen, als sie selbst bis in den
chiapanekischen
Dschungel Südmexikos anläßlich eines interkontinentalen
Encuentros gereist sind. "Am Anfang haben wir vorhergehende
Formen der Direkten Aktion diskutiert, der Sabotage, der
revolutionären
Gewalt usw. Wir haben daraus geschlossen, dass unter den
aktuellen
Bedingungen der Zivilgesellschaft, der Gebrauch unserer Körper
als Waffe die Kräfte derjenigen Menschen freisetzen könnte,
die zu den alten Formen und Schemen nicht geantwortet haben. Es
ist eine kreative Form die andere Seite in ein Problem mit
einzubeziehen.
Mit gewaltfreien Mittel der Direkten Aktion, bleibt die Sprache
der Gewalt auf die Seite der Polizei und des Staates. Klassische
Demonstrationen beeindrucken sie nicht mehr, jetzt sind wir als
BürgerInnen ungehorsam, sie schlagen zurück, aber wir
verteidigen uns. Das zieht die Aufmerksamkeit der Menschen und
gibt
unserem Protest Echo".
Diese konfrontative Haltung macht Sinn: das tiefverwurzelte
(Selbst)bild
des Staates als Institution, die die Interessen aller vereint,
ist
im neoliberalen Zeitalter stark am bröckeln, in Italien auf
jeden Fall früher als in der BRD.
Ein offen in Erscheinung tretender Interessengegensatz zwischen
legitimen Bedürfnissen von BürgerInnen und staatlichen
Maßnahmen sind eine gute Voraussetzung für emanzipative
Prozesse, weg von der Forderung an den Staat, sozial abfedernd zu
agieren oder ökonomisch steuernd zu intervenieren mit dem
Anspruch,
einen Wohlstand für alle zu sichern. "Unser Beitrag ist
eine radikale Form der Konfrontation, die über die klassischen
Formen der Demonstration hinaus geht und die Möglichkeit einer
Massenbeteiligung mit sichereren Methoden ermöglicht. Junge
Leute sehen, daß der Einsatz ihres vor der Polizei geschützten
Körpers klare Wirkungen hat. Die Bewegung wächst. Wir
sind nicht eine politische Gruppe, es handelt sich um eine
horizontale
Bewegung, in der jede Person auf ihre besondere Weise zur Debatte
und Organisation beiträgt. Alles ist untereinander verstrickt,
es gibt Leute allen Alters. Alte Modelle von Avantgarden und
Anführer
sind vorbei."
In einem Flugblatt schreiben sie: "Wir haben uns eine neue
Herausforderung gesetzt: aus dem Boden zu sprießen, um uns
auf diese Weise in den Aufbau der Gesellschaft einzubringen, um
die Selbstverwaltung und Selbstorganisation zu fördern, die
in den letzten Jahren aufgebaut wurde. Wir wollen uns vom
Widerstand
in eine Offensive bewegen, hin in die Arena der Träume, der
Rechte, der Freiheit, für die Eroberung der Zukunft, die heute
den neuen Generationen verweigert wird".
Wie die Zapatistas erkennt Ya Basta, dass die Befreiungsprozesse
notwendigerweise kontinuierlich in Frage gestellt und neu
definiert
werden müssen . "Wir gehen mit Fragen auf unseren Lippen",
sagen sie, " nicht mit Befreiungsstrategien, die als absolute
Wahrheit festgelegt werden. Diese Tabus, die die Bewegungen der
Vergangenheit charakterisiert haben, müssen hinter uns gelassen
werden".
- Die Rolle der Kommunikation: Die Unsichtbaren sichtbar
machen
-
Die weißen Overalls werden als Symbol der Unsichtbarkeit
getragen,
als Idee der 'nicht-Identität' (siehe 'sans papiers'). Die
Aktionsform hat eine stark symbolische Wirkung und kommunikative
Stärke. Für sie entspricht der Aufbau einer Gesellschaft
der Praxis einer sicheren Identität, aber mit offenen
Beziehungen.
Sie versuchen viele anzusprechen und in den Konflikt mit
einzubeziehen,
dazu wollen sie "Kommunikationsräume erobern". Organisation
und 'Centri Soziale' Organisisiert sind die AktivistInnen zum
größten
Teil in ihren 'sozialen Zentren', besetzte und selbstverwaltete
Häuser oder Gelände, die in vielen Städten zu finden
sind.
Wie schon erwähnt, findet mensch hier Leute, die sich zu Ya
Basta zählen oder nur zum sozialen Zentrum oder beides. Auf
der Straße sind aber alle unter 'Tute Bianches' zu finden.
Der wohl größte und beeindruckendste Centro Soziale ist
der Leoncavallo in Mailand, der eine lange Widerstandsgeschichte
hat. Das Gelände ist enorm: mehrere Räume, Cafés,
Bühnen, eine Kantine, ein Buchladen, Büro- und Plenumsräume,
ein Konzertraum in dem Konzerte für 5000 Leute veranstaltet
werden können und noch viel mehr. Alles selbstverwaltet.
Auffällig ist, das mensch nicht nur junge Leute sieht, sondern
alle Generationen. Eine Kontinuität in der Widerstandsgeschichte
ist spürbar. Eine ältere Frau, die hier als 'la madre'
vorgestellt wird, erzählt Geschichten: unter anderem, wie sie
in Argentinien war und die 'madres de la plaza de mayo 'getroffen
hat. Sie sagt, daß über 1000 Gerichtsverfahren gegen
ca. 200 Leute aus dem Centro Soziale am laufen sind, dass sich
aber
alle kollektiv den Ermittlungen entgegenstellen. "Wir machen
weiter", sagt sie mit einem strahlenden Lächeln, während
sie die Kippenfilter von einer Veranstaltung wegfegt. Sie scheint
jede und jeden im Haus zu kennen.
Die Centri Soziale sind alle untereinander vernetzt und
mobilisieren
oft gemeinsam, wie z.B. nach Prag. In jedem Centro Soziale
bestehen
kleine Bezugsgruppen, die bestimmte Rollen in der Aktion der Tute
Biaches üben und sich Gedanken zur Schutzkleidung machen.
aus: http://www.sterneck.net/politik/tute-bianche-widerstand/index.php, 05.04.2010
Siehe auch: Eintrag "Tute Bianche" auf diesem Blog.
Tute Bianche
DIE TUTE BIANCHES, ZAPATISMUS
UND WIDERSTANDSKULTUR IN ITALIEN
Spätestens seit den Protesten in Prag anläßlich
des IWF/Weltbankgipfels 2000 sind die Bilder der Tute Bianches,
der weiß gekleideten und gepolsterten AktivistInnen aus Italien,
wie ein Mythos um die ganze Welt gegangen. Hinter der Aktionsform
verbirgt sich eine Suche nach einem Befreiungsprozess aus den
Zwängen
der kapitalistischen Welt. "Wir sind eine Armee von Träumern,
deshalb sind wir unbesiegbar" schreiben die AktivistInnen auf
ihren Transparenten und Broschüren.
Nach Prag sind fast 900 AktivistInnen aus Italien mit einem Zug,
dem Global Express, gekommen. Davon haben sich ca. 100 aktiv an
der Aktion der Tute Bianches beteiligt. Hinter ihnen, eine grosse
Menschenmenge zur Unterstützung, neben ihnen die Medien der
ganzen Welt und vor ihnen die Robocops des Staates mit Panzern,
Wasserwerfern, Schlagstöcken und Pfefferspray. Die sogenannte
Demokratie des IWFs und der Weltbank hinter Panzer und Gitter.

- Der Körper als Waffe des Zivilen Ungehorsams -
"Wenn die Welt zu verkaufen ist, ist rebellieren
selbstverständlich"
Die Tute Bianches sind gut ausgerüstet und benutzen dazu
hauptsächlich
billige Materialien und ihre Kreativität: Matratzen, alte Reifen,
Baustellenhelme, Rettungsjacken, Armpolster aus Isomatten und
Isolierband,
Gasmasken, aber auch Luftballons, Wasserpistolen oder
selbstgemachte
Schutzschilder kann mensch in ihrem Repertoire finden. Wieso ?
"Gegen
eine Welt in der das Geld alles regiert, bleiben uns nur noch
unsere
Körper, um gegen die Ungerechtigkeit zu rebellieren",
meint Don Vitaliano, ein Pfarrer, der auch unter den Tute
Bianches
zu finden ist. " Wir sind nicht bewaffnet, wir agieren als
Menschen und setzen unsere Person ins Spiel. Wir fürchten uns
vor der Polizeigewalt, deshalb schützen wir uns."
Diese Aktionsform begann vor knapp einem Jahr in Italien und
überraschte
alle durch ihren Erfolg. Im Januar 2000 gab es bundesweite
Mobilisierungen
gegen Abschiebeknäste in Italien. Mehrere zehntausend Menschen
sind dafür auf die Straße gegangen.
Die Demonstration gegen den Abschiebeknast Via Corelli war ein
besonderer
Erfolg. Die Tute Bianches hatten ihre Entschlossenheit
angekündigt
in den Abschiebeknast einzudringen und zu schliessen. Die mehrere
Tausend Tute Bianches marschierten vorne und mussten stundenlang
Auseinandersetzungen mit der Polizei aushalten, bevor diese dann
aufgeben musste und die Leute ins Lager eindringen konnten.
Abends
kündigte der Innenminister die Schliessung von Via Corelli
an. Die aufgeblasenen Reifen dienen dazu die Schlagstöcke der
Robocops rückprallen zu lassen. "Über 150 Tränengaspatronen
haben wir bei dieser Aktion gezählt" grinst ein junger
Aktivist. Die rauchenden Tränengaspatronen werden in Kisten
oder unter Eimer geworfen, um sie zu neutralisieren. Es erinnert
an eine Beschreibung Ghandis des zivilen Ungehorsams: 'Feuer mit
Wasser löschen'.
Seitdem sind Tute Bianches auf vielen Mobilisierungen zu sehen:
Antifaschistische Demos, Mobilisierungen gegen den OECD Gipfel in
Bologna oder gegen die Eröffnung der Gentechweltausstellung
in Genua bei der sie bis zum Eingang eingedrungen sind und die
Ausstellung
zum Fiasko und nationalen Debatte gezwungen haben.
aus: http://www.sterneck.net/politik/tute-bianche-widerstand/index.php, 05.04.2010
Siehe auch: Beitrag "Ya Basta" auf diesem Blog.
indymedia.org
Seit dem Ende des kalten Krieges ist es zu einer nie dagewesenen Zusammenballung etablierter Medienmacht gekommen. Medienkonzerne verbreiten über unzählige Kanäle ihre vielfach durch politische u./o. wirtschaftliche Interessen gefärbten Informationen und konstruieren somit Kraft ihrer Definitionsmacht ein Bild der Realität, das teilweise in krassem Gegensatz zu einer von vielen Menschen ganz anders erlebten Wirklichkeit steht.
Dies erschwert weltweit die Arbeit verschiedenster AktivistInnengruppen, deren Einsatz für mehr Gerechtigkeit von den grossen Medien systematisch übersehen und deren Anliegen u. Aktivitäten gefiltert, verzerrt oder gar nicht dargestellt werden - solange es nicht 'ins Bild passt'.
Um solch massive 'Lücken', die jede komplexere Wahrheitsfindung verhindern, auszufüllen, begannen Menschen in den verschiedensten Teilen der Erde alternative Informationskanäle u. Verbreitungswege aufzubauen wie z.b. Untergrundmagazine, freie Radio- u. Fernsehsender, unabhängige Filmproduktionen etc.
Diese Ansätze zu vernetzen und dadurch auch in ihrer globalen Gegenpräsenz zu verstärken war dann einer der Hauptgedanken, die zur Entstehung von indymedia führten.
indymedia/IMC trat unter diesem Namen und den damit verbundenen Medienstrategien (wichtige Schwerpunkte: Internet / Open Posting ) im November '99 in Seattle anlässlich der Proteste gegen die WTO und globalen Kapitalismus an die Weltöffentlichkeit, indem die IMC-Seite während dieser Zeit eine minutiöse Berichterstattung von AktivistInnen über das Geschehen vor Ort lieferte.
Das Internet bot hier die Möglichkeit, unabhängig vom einzelnen Individuum einen massiven Informationsfluss zu koordinieren, eine Diskussionsplattform zu bieten und somit in Kooperation mit anderen Medienkanälen grösstmögliche Öffentlichkeit zu schaffen.
Seitdem entstanden v.a im Zusammenhang mit politischen Grossveranstaltungen weltweit immer mehr neue indymedia-Zentren, die sowohl regional als auch international alternatives Nachrichtenmaterial veröffentlichen.
aus: http://de.indymedia.org/static/ms.shtml, 05.04.2010
Avaaz.org
Avaaz ist eine neue globale Internetbewegung, die mit demokratischen Mitteln für eine gerechtere Welt kämpft.
Weltweit wünschen sich Menschen an sich grundsätzliche Verbesserungen: den Schutz der Umwelt, die Achtung von Menschenrechten und die Bekämpfung von Armut, Korruption und Krieg. Gleichsam bedeutet Globalisierung ein enormes demokratisches Defizit, da Entscheide auf internationaler Ebene von wenigen politischen Eliten und unverantwortlichen Unternehmen getroffen werden und zumeist nicht den Meinungen und Wertvorstellung der Weltbevölkerung entsprechen.
Dem technologischen Fortschritt durch das Internet ist es zu verdanken, dass sich Menschen weltweit einfach und schnell vernetzen können. Eine neue Form der Internetbasierenden Mobilisierung gibt Bürgern eine Stimme und verändert die politische Landschaft in Australien, den Philippinen und in den Vereinigten Staaten von Amerika. Avaaz nutzt diese neue Form grenzüberschreitender Kommunikation, um Millionen Menschen rund um den Globus eine Stimme zu verleihen, um dadurch Entscheidungsprozesse auf internationaler Ebene zu beeinflussen.
Auf diesem Weg wurde Avaaz schnell eine breitgefächerte Gemeinschaft von Menschen unterschiedlichster Nationen, Kulturen, Herkunft und Altersgruppen.
Der Kern der Funktionsweise ist die in 13 Sprachen verfügbare Email-Liste. Nachdem man sich in die Liste eingeschrieben hat, erhält man automatisch Benachrichtigungen über aktuelle weltpolitische Ereignisse und die Möglichkeit konkret etwas zu verändern. Dadurch ist es dem Avaaz-Netzwerk in kürzester Zeit möglich, durch Unterschriftensammlungen oder über Botschaften an politische Entscheidungsträger Druck zu erzeugen, um den Standpunkt einer Vielzahl von Menschen deutlich zu machen. In wenigen Stunden werden Tausende von Nachrichten an politische Entscheidungsträger gesendet, um sie beispielsweise aufzufordern wichtige Klimaverhandlungen zu retten. Unterschriftensammlungen erlaubten es in kürzester Zeit starke Solidaritätsbotschaften zu senden und Spendenaktionen unterstützen diverse Gruppen mit mehreren Hunderttausend Euros, Dollars und Yen.
http://www.avaaz.org
Empire
Die neue Weltordnung, Autoren: Michael Hardt, Antonio Negri
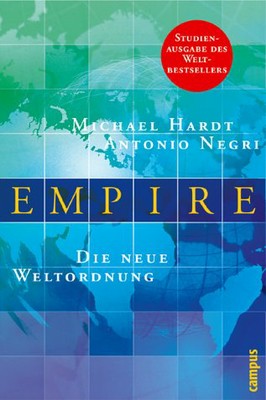
"Empire" ist eine politische Diagnose des postmodernen Kapitalismus im Zeitalter der Globalisierung. Die Phase des Imperialismus ist zu Ende, abgelöst wurde er vom "Empire", einem Weltreich ohne Zentrum und mit umfassendem Herrschaftsanspruch, das in seinem rastlosen Drang nach Ausdehnung jeden nationalstaatlichen Rahmen sprengt. Zugleich ist es ein Reich vollendeter Totalität, in dem es keinen moralischen oder kritischen Standpunkt von "außen" mehr gibt. Es verfügt über eine biopolitische Maschinerie, die jeden Einzelnen kontrolliert. In den Arbeitsformen der "New Economy", wo intellektuelles Wissen und die Hoffnung auf eine bessere Welt zusammenfließen können, verorten die Autoren ein neues "Proletariat". In ihrer Analyse entwickeln sie den Gedanken der Vielheit der Menschen, die nach Wegen zu einer neuen Gesellschaft sucht.
Wagenplatz
Ein Wagenplatz ist eine Wohnsiedlung aus mobilen Fahrzeugen, meist Bauwagen.
Wagenplätze entstanden beispielsweise nach dem zweiten Weltkrieg, als Flüchtlinge keine andere Unterkunft hatten. Aus dieser Zeit stammen auch Gesetze, die später das Wohnen in Bauwagen (mit Ausnahmen) untersagen.
Die heutigen Wagenplätze sind, ähnlich wie viele besetzte Haäuser Orte alternativer Kultur. Diese Wagendörfer entwickelten sich Mitte der 1980er Jahre aus der Hausbesetzerszene. Oft werden Wagendörfer von den Grundbesitzern und Behörden nur geduldet und sind ständig in Gefahr, geräumt zu werden. Bewohner betrachten das Leben in Wagendörfern als einen „Ausstieg aus der konsumorientierten Gesellschaft“ und einen „Schritt hin zu selbstbestimmter Lebensweise“, aber auch als Möglichkeit mobilen Lebens. Man findet auf den Plätzen manche fantasievolle Eigenbauten.
Einige Wagenplätze befinden sich auf illegal besetzten Flächen, andere haben Mietverträge mit der jeweiligen Stadt, fast alle haben einen Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss. Die Bewohner haben diese Wohnform selbst gewählt.
Gegner hinterfragen etwa die hygienischen Zustände auf Wagenplätzen oder den legalen Status und fordern Verbote und Räumungen. So wurde im Hamburger Konflikt um den Baumbule-Wagenplatz von der Stadt die Forderung erhoben, die Bauwagenbewohner sollten einzeln ihnen angebotene Wohnungen am Stadtrand beziehen, oder andernfalls außerhalb Hamburgs gemeinsam im ländlichen Gebiet leben.
Befürworter des Bauwagen-Lebensstiles verweisen auf die geringen Lebenshaltungskosten, die Möglichkeit zur Mobilität, das soziale Leben im Gegensatz zur Vereinzelung in der Single-Wohnung, und fordern Toleranz für selbstbestimmtes Wohnen und die Legalisierung ihrer Wohnform. Im Hamburger Konflikt forderten sie das Recht auf Teilhabe an der Stadt, die Respektierung ihrer Lebensform und die Abschaffung der Bauwagengesetzgebung.
Durch ihren sozialen und politischen Anspruch unterscheiden sich Wagenplätze von den ökonomisch begründeten Trailer-Parks.
Infoläden
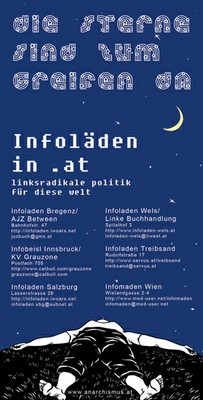
WAS SIND INFOLÄDEN?
- Inhalte und Struktur -
Die Bandbreite der in Infoläden vertretenen Inhalte reicht von Flüchtlingspolitik und Antifaschismus über Feminismus und Gender bis hin zu Repression, Knast und Gefangene, soziale Kämpfe, linksradikale Politik im Allgemeinen, Globalisierung, sowie Internationalismus, Antinationalismus, Drogen, (Sub-) Kultur und vielem mehr (wobei die Reihenfolge nicht hierarchisch und abschließend gemeint ist).
Infoläden werden genutzt und getragen von Menschen mit unterschiedlichsten politischen Überzeugungen aus dem undogmatischen linksradikalen Spektrum. Hier wurden und werden Informationen zumeist in Form von Zeitschriften, Broschüren und Flugblättern aber auch Büchern, Videos und Ton- und Datenträgern gesammelt, diskutiert und verbreitet. Die Arbeit umfasst aber auch die Organisation und/oder Teilnahme von Aktionen, Veranstaltungen und Demonstrationen zu unterschiedlichen Themen und die Platzierung linker Inhalte und Debatten in derÖffentlichkeit.
- Geschichte -
In den 80er Jahren (im Osten ab Anfang der 90er) sind in immer mehr Städten in der BRD, aber auch international, Infoläden entstanden. Die Entstehung der Infoläden hängt unter anderem damit zusammen, dass der Austausch und die Diskussion von und über staats- und gesellschaftskritische Themen be- und verhindert wurde und wird. Somit sind Infoläden auch ein Versuch, entgegen der kapitalistischen Verwertungslogik, zu informieren, Machtverhältnisse zu thematisieren und diesen entgegenzutreten.
Ein weiterer entscheidender Punkt war und ist auch das immer weiter um sich greifende Wegfallen von selbstbestimmten, linksradikalen Orten und Plätzen, in den 80ern vor allem in Form der (ehemals) linken Buchläden. In den 90ern war dies eher das Wegfallen autonomer Zentren und besetzter Häuser, die meist auch ihren Teil in der linksradikalen Kommunikations- und Informationsstruktur inne hatten. Einen weiten Teil dieser Aufgaben haben Infoläden übernommen.
- Selbstverständnis -
Infoläden begreifen sich als Teil autonomer Organisierung. Sie streben eine Vernetzung mit Gruppen aus der eigenen Stadt und darüber hinaus an, organisieren sich aber auch auf regionaler und länderübergreifender Ebene mit anderen Läden. Zum einen werden so durch diese hierarchisch flach organisierten Strukturen Informationen erhalten, die vom herrschenden Diskurs unterdrückt werden. Zum anderen ist es dadurch möglich, Erfahrungen und Standpunkte auszutauschen und zu diskutieren, die wiederum für neue Konzepte und Ideen nutzbar gemacht werden sollen.
Vienna Bikekitchen
Die Fahrrad Selbsthilfe Werkstatt im 15.
Die Fahrradküche ist ein öffentlich zugänglicher Raum in der Goldschlagstraße 8, in 1150 Wien (Stadtplan), der eine Werkstatt, eine Küche und ein Wohnzimmer (einen Veranstaltungsbereich) beherbergt. Die juristische Basis ist ein Verein. In Theorie und Praxis jedoch sollten sich alle Mitwirkenden als Teil eines hierarchiefreien und offenen Kollektivs verstehen. Das Projekt verfolgt keine kommerziellen Interessen, aber wir müssen natürlich unsere anfallende Kosten (Miete, Werkzeug, Propaganda, Küche etc.) decken.
Wir sind ein Verein zur Förderung der Fahrradkultur in Wien und wollen einen sehr niederschwelligen, spassvollen, selbstbewussten und verantwortungsvollen Zugang zum Thema Fahrrad anbieten. In der Bikekitchen kann mensch Fahrräder reparieren und kaputt machen, zerlegen und daraus Choppers (Tallbikes, Longbikes, Einräder, Lastenräder, Anhänger, etc…) konstruieren. In der Bikekitchen haben wir eine Menge gebrauchte Ersatzteile und auch Räder, die mit eigenem Aufwand fahrtauglich gemacht werden können. Weiter kannst du Aufgußgetränke bereiten und Weinflaschen entkorken, ein Brot toasten oder gleich für alle kochen, um im Anschluss gemeinsam zur Demo zu fahren.
Wichtige weitere Schlagworte: Antikapitalistisch, Feministisch, Antisexistisch, Antirassistisch, Kollektiv, Plenum, Konsens, Criticalmass, Fuhrpark, (Raum)Gestaltung, DIY, Soli, Schablonen/Stencil, Dumpstern/Kontainern, Bar, Beisl, Cafe, Fachliteratur, Archiv, Fahrradfetischismus, Bike Art, Bike Fun, Bike Kill, Joustings, Bike Polo, Nachtfahrten, Demoperformance, Aktionen, Screen Printing, Workshops, Ausflüge, Karawanen, Filme u. Videos schaun und machen, Hörspielabende, Schrott sammeln, Lesekreis, Konzerte, Auflegerei, Experimente aller Art, …
Critical Mass
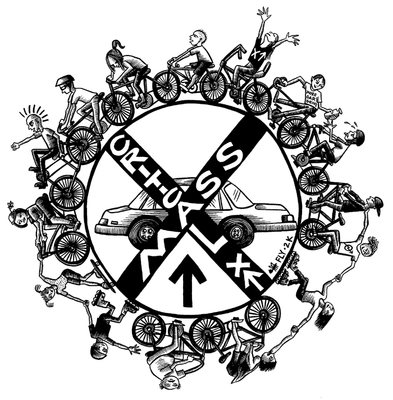
Critical Mass ist ein Treffen von FahrradfahrerInnen, die sich gelegentlich den Platz auf der Straße nehmen, der Ihnen im alltäglichen Verkehr durch jahrelange verfehlte Verkehrs- und Stadtplanung und rücksichtslose Autofahrer verweigert wird.
Die CRITICAL MASS sucht durch ihre Präsenz den friedlichen Dialog am Ort des Geschehens: auf der Straße. Wir sind viele FahrradfahrerInnen, die versuchen, gemeinsam so gut wie möglich vorwärts zu kommen. Wir halten die Verkehrsregeln ein. Jeder passt auf die anderen auf und hält die Gruppe zusammen. Um zusammenzubleiben bewegen wir uns langsam voran. Wir haben Musik dabei, die Lust auf Bewegung macht – geschmeidige, runde Bewegungen, die uns durch die Stadt rollen lassen.
ALLE die hier und jetzt teilnehmen, bilden eine KRITISCHE MASSE: RadfahrerInnen, die uneingeschränkt radfahren wollen. Menschen, die den dadurch gewonnen Raum lustvoll erleben und den sonst so hektischen Straßenverkehr friedvoller mitgestalten wollen.
Seit dem Beginn der Critical Mass Bewegung 1992 in San Francisco hat sich die CRITICAL MASS zu einer globalen Bewegung entwickelt, die noch immer das selbe Ziel wie damals verfolgt: Sie soll zu voller Akzeptanz der FahrradfahrerInnen im Straßenverkehr führen, genügend Raum und Achtsamkeit für sie erreichen und allgemein zu einem respektvolleren und bewussteren Umgang zwischen allen VerkehrsteilnehmerInnen beitragen.
Das Fahrrad stellt ein wichtiges Element der Mobilitätskette dar und verdient daher vollwertige verkehrspolitische Anerkennung und Förderung als nachhaltigstes, klügstes, gesündestes Nahverkehrsmittel.
BESSER MITEINANDER ALS GEGENEINANDER!
Das Handbuch der Kommunikationsguerilla
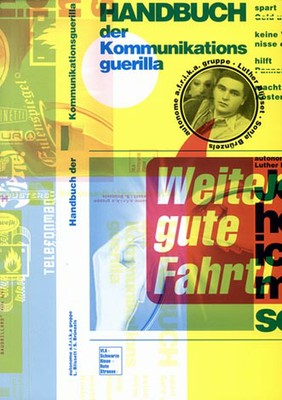
Das Handbuch der Kommunikationsguerilla beschreibt Prinzipien, Methoden, Techniken und Praxen, Gruppen und Aktionen, die in gesellschaftliche Kommunikationsprozesse eingreifen. Kommunikation beschränkt sich dabei nicht auf Massenmedien, sondern bezieht die alltäglichen Formen der face-to-face-Kommunikation mit ein. Das Buch entstand in der Absicht, linke politische Praxis und Theoriebildung zusammenzudenken und weiterzuentwickeln, anstatt sie gegeneinander auszuspielen. Ausgangspunkt war die Frage, wieso linke "Gegenöffentlichkeit" oft erfolglos bleibt bei dem Versuch, Positionen überhaupt Gehör zu verschaffen. Das Handbuch entwickelt erstens ein Konzept politischer Aktionsformen, das sich nicht auf Klartext und herkömmliche Formen der Militanz beschränkt. Vielmehr beschreibt es verblüffende, witzige und unvorhersehbare Mittel, die zwar für sich genommen schon lange Bestandteil linker Politikformen sind, aber bislang mehr als unwesentliches Beiwerk unterschätzt wurden. Das Handbuch enthält zweitens Beschreibungen von Personen und Gruppen, die mit Kommunikationsguerilla zu tun haben: von Dada über die Situationisten bis hin zum Büro für Ungewöhnliche Maßnahmen oder KPD/RZ. Frühere politische Bewegungen werden dabei nicht nur als gescheiterte Versuche verstanden, sondern ihre Geschichte steht als Anknüpfungspunkt für eine Weiterentwicklung linker Politikformen. Drittens liefert das Handbuch kurze Beschreibungen von Aktionen der Kommunikationsguerilla, die die vorgestellten Politikformen illustrieren und Anregungen für eigene Vorhaben zur Verfügung stellen. Das Handbuch der Kommunikationsguerilla ist viertens ein Nachschlagewerk und bietet einen Überblick über Namen, Adressen und Aktionen von Kommunikationsguerilleras.
Kommunikationsguerilla
Was ist Kommunikationsguerilla?
Die Kommunikationsguerilla ist eine etwas andere Form der Militanz. Kommunikationsguerilla ist eine politische Militanz, die einer radikalen Kritik der Gesellschaft den Weg weist, die hilft, sich der vielfältigen Vereinnahmungsstragtegien zu entziehen und immer wieder versucht, "Ordnung der Dinge", den Horizont der bestehenden Wirklichkeit zu überschreiten. Das "Konzept Kommunikationsguerilla" ist eng verknüpft mit einer Haltung, die sich einerseits der Logik traditioneller Politik mit ihren Konzepten von Aufklärung, Überzeugung und Wahrheit entzieht, aber andererseits auf eine aktive Kritik des Bestehenden nicht verzichtet. Kommunikationsguerilla meint keine Mediensabotage im Sinne der Unterbrechung eines Sendekanals. Sie untersucht die Struktur der politischen Kommunikationund interveniert mit dem Ziel der Delegitimierung von Herrschaft. Die Kommunikationsguerilla versucht Antworten auf Fragen zu finden, wie
- Wie ruiniert man die Redeveranstaltung eines Regierungspolitikers?
- Welche Chancen des subtilen und wirksamen Eingreifens bieten die bürokratischenPapierberge der Administration?
- Welche Möglichkeiten gibt es im Rahmen von Wahlen, bei repräsentativen Staatsereignissen oder gegen den ganz alltäglichen Rassismus?
aus: http://www.contrast.org/KG/, 05.04.2010
No Logo
Naomi Klein
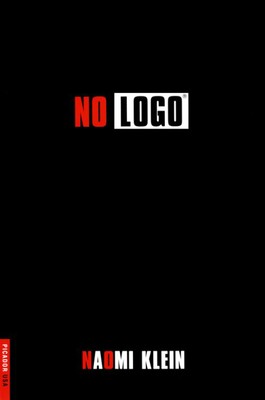
In ihrer scharfsinnigen Studie offenbart Naomi Klein die Machenschaften
multinationaler Konzerne hinter der Fassade bunter Logos. Der von ihr
propagierte Ausweg aus dem Markendiktat ist eine Auflehnung gegen die
Täuschung der Verbraucher, gegen menschenunwürdige Arbeitsbedingungen,
Zerstörung der Natur und kulturellen Kahlschlag. Durch ihre
Demystifizierung verlieren die großen, global agierenden Marken an Glanz
und Macht - zum Wohle aller. Marlboro verkauft nicht Zigaretten, sondern
Freiheit; Lewis verkauft nicht Klamotten, sondern einen
unkonventionell-coolen Lebensstil; Nike verkauft Sportsgeist... Es
existiert ein gewaltiger Unterschied zwischen dem Logo, dem Image einer
Marke und dem Produkt selbst. Die großen Firmen nutzen dies aus. Sie
nutzen die Suche der Menschen nach inneren Werten, um ihre Produkte zu
verkaufen. Im Zeitalter des globalen Kapitalismus verkauft uns die
Produktwerbung all das, was wir im täglichen Leben vermissen:
Selbstverwirklichung, Freundschaft, Kommunikation, Freiheit, Sicherheit,
Glücksgefühle und Spiritualität.
Die 29-jährige Journalistin Naomi
Klein analysiert, was die viel beschworene Globalisierung den Menschen
tatsächlich an Freiheit, Vielfalt und Wohlstand gebracht hat. Das
Ergebnis ihrer Studie ist erschütternd. Denn während Großunternehmen die
freie Wahl der Verbraucher propagieren, beherrschen sie mit ihren
Marken die Medien, den öffentlichen Raum und machen selbst vor Schulen
und Bildungseinrichtungen nicht Halt. Den finanziellen Aufwand, den sie
erbringen müssen, um ihre Marken zu managen, sparen sie bei der
Herstellung der Produkte ein. In Indonesien, China, Mexiko, Vietnam oder
auf den Philippinen produzieren sie in Freihandelszonen, in
ghettoähnlich abgeschirmten "sweatshops", frei von Steuern,
Umweltauflagen und Sozialabgaben so billig, dass Gewinnspannen bis zu
400 Prozent erzielt werden.
Naomi Kleins Buch bringt eine
kulturkritische Auseinandersetzung in Gang. Ihre Kritik richtet sich
nicht nur gegen die Irrwege multinationalen Marketings, sondern ebenso
gegen unsere Gesellschaft, die es versäumt, relevante Fragen rechtzeitig
aufzugreifen und das Feld den Marketingmanagern und Werbestrategen
überlässt. Dieses Versagen bewirkte, dass Gleichheit, Toleranz und
andere ethische Werte plötzlich von Marken wie Nike oder Calvin Klein
besetzt werden konnten und die Diskussion über die Todesstrafe in den
Vereinigten Staaten auf den Werbeplakaten von Benetton stattfand. Naomi
Klein registriert aber auch eine gegenläufige Entwicklung. Im vierten
Teil ihres Buches spürt sie beeindruckende Aktivitäten von Menschen auf,
die es nicht länger hinnehmen, dass die Dritte Welt zur Steigerung des
Komforts in der Ersten Welt missbraucht wird, dass Kinder unter
katastrophalen Arbeitsbedingungen Computer bauen, die sie niemals in
ihrem Leben werden besitzen oder auch nur bedienen können, und dass die
Freiheit des Wortes in kommerzieller Kakophonie untergeht. Die Boykotte
gegen Pepsi, Shell, McDonald's und andere zeigten, dass Konzerne sehr
wohl verletzlich sind. Vor diesem Hintergrund ist Naomi Klein überzeugt:
Je mehr Menschen das hässliche Gesicht hinter der glänzenden Maske des
Logos entdecken, umso mächtiger wird die Welle des Widerstandes gegen
multinationale Konzerne, die den Verbraucher täuschen und die
Globalisierung der Arbeitsplätze zur Ausbeutung missbrauchen.
Rotzfreche Asphalt Kultur
Die Rotzfreche Asphalt Kultur (RAK) ist ein Zusammenschluss linker Straßenmusiker_innen, Kabarettist_innen und Theaterleute. Seit nunmehr 30 Jahren machen die RAKis in unterschiedlichen Besetzungen und Generationen die Straßen unsicher mit dem Versuch, etwas Chaos und Träume in die Köpfe zu streuen und den grauen Alltag umzukrempeln.

Die RAK bildete sich 1978 als Dachverband verschiedener kultureller
Gruppen auf dem “Bundeskongress der Bürgerinitiativen gegen Atomkraft”.
Aber bald redete keiner mehr von Dachverband. Bald sagte man
nur noch RAK und damit meinte man sich selber, alle anderen
Straßenmusiker, Liedermacher, Theatergruppen, Jongleure und
Clowngruppen.
Die RAK war ein Zusammenschluss, so etwas wie ein
Berufsverband ohne Beitragsgelder und besteht auch heute noch als
lockerer Zusammenhang linker Straßenkünstler_innen.
Nicht alle waren bei der RAK dabei, aber alle die wollten,
konnten mitmachen; die Organisation war schon immer sehr anarchisch. Es
gab keine Hierarchie und keine Vorsitzenden (und wenn es einer versucht
dann wird er meistens nicht ernst genommen).
Wichtiger ist uns die Solidarität und der Austausch.
Wir sehen die Straße auch immer als Raum unsere Ideen,
Kritiken und Träume in die Welt zu tragen und den grauen Alltag
ordentlich auf den Kopf zu stellen. Musik allein hat zwar noch keine
Gesellschafts"ordnung" umgeworfen,aber wir sehen unsere Kultur als ein
Stück gelebte Utopie und glauben, dass sie unmittelbarer und direkter
wirkt als verteilte Flugblätter.
Trotz dem Straßenmusikverbot in vielen Städten, gingen wir
immer wieder auf die Straße. Unvergessen bleiben jene Tage, in denen
etwa 50 RAK-Musiker_innen Straßen und Plätze in Freiburg besetzten und
immer dort musizierten, wo die Polizei gerade nicht
Strassenmusiker_innen verhaftete.
Damals traf sich die RAK regelmäßig in diversen Städten wie
Wuppertal, Braunschweig, Freiburg oder Bremen. Die Treffen endeten
immer mit einem gemeinsamen Galaabend, an dem jede der teilnehmenden
Gruppen 20 Minuten lang auftrat. Das Programm war meist sehr lang und
zeigte oft ein breites Spektrum der Straßenkunst: vom anstrengenden und
mit viel Inbrunst vorgetragenem “ganz linken Lied” und Spontantheater
über mehr unterhaltsamere akrobatische Nummern, folkmusikalische
Darbietungen bis hin zu sehr stillen Musikperformances gab es alles, was
auf die Straße passte.
Eine Diskussion, die immer wieder aufflammte:
Ist RAK jetzt nur “politische Lieder gegen was” spielen,
oder gehört auch Straßenmusik in weitestem Sinne dazu, wie z.B.
Akkordeonmusik, die einfach die Innenstädte belebt? Ist “einfach Musik
machen” schon politisch genug? Wirkt man damit schon genügend gegen das
Establishment ?
Aber Grundsatzdiskussionen zogen sich niemals zu lange hin:
Wortführer wurden einfach gepackt und an den Beinen aus dem Fenster
gehalten. Erwies sich das als zu schwierig, übte man sich im Ignorieren
von Kritik.
Die RAK hat viele Bands inspiriert und beeinflusst und viele
alte Bekannte waren (oder sind noch) Teil von ihr wie zum Beispiel:
Milch und Blut, Quetschenpaua, Brundibar One Man Band oder Klaus der
Geiger. Heute gibt es eine wachsende Zahl von „jüngeren“ Bands im Umfeld
der RAK. Wie zum Beispiel: Früchte des Zorns, Revolte Springen, Teds n
Grog, Schall und Rauch, Geigerzähler und viele andere.
Mittlerweile können wir auf 30 Jahre Geschichte zurückblicken. Und die wenigsten von uns haben sie ganz miterlebt.
But the Future is unwritten and the Show must go on!




